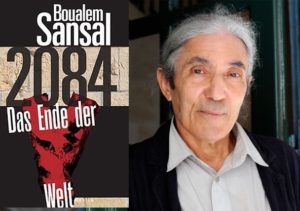Albert Memmi – Tunesischer Schriftsteller und Soziologe

„Ich bin davon überzeigt, dass die beste Art, Nordafrika kennenzulernen darin besteht, seine Schriftsteller zu lesen“, so konstatiert der renommierte tunesische Schriftsteller und Kolonialismusforscher Albert Memmi in seinem Vorwort zur Anthologie frankophoner maghrebinischer Schriftsteller.
Albert Memmi, geboren 1920 in Tunis, ist Schriftsteller und Soziologe französischer Sprache und lebt in Paris. Er lehrte an den Universitäten von Paris und Washington D.C. In Deutschland wurde Memmi vor allem durch seine Schriften zu Kolonialismus, Rassismus und gesellschaftlichen Randgruppen bekannt. Er untersuchte in über 20 Büchern die Dekolonisation, den Rassismus und die Emigration und hat das Lebensgefühl der Entfremdung und Entwurzelung zur Sprache gebracht hat. Für Albert Memmi ist der Rassismus die Bedeutung von der Hervorhebung der Unterschiede. Jemand hebt die Unterschiede des Opfers hervor und nutzt diese Wertung zu seinem Interesse. Der Rassismus so Memmi, enstehe erst durch die Verknüpfung.
Memmi zählt zu den Gründervätern der maghrebinischen Literatur französischer Sprache und gilt neben Frantz Fanon als Haupttheoretiker des Anti-Kolonialismus (Portrait du colonisé. Précédé du portrait du colonisateur, 1979; dt. Der Kolonisator und der Kolonisierte) sowie als Vordenker des Anti-Rassismus (Le racisme, 1982 ; dt. Rassismus) im Geiste der Aufklärung, der sich dem Ideal eines laizistischen Humanismus verpflichtet weiß (Testament insolent, 2009). In viel beachteten Essays spürt Memmi den soziopolitischen Mechanismen von Auflehnung und Unterdrückung gesellschaftlicher Randgruppen nach – Portrait d’un Juif (1962), La libération du Juif (1966), L’homme dominé, (1968), Juifs et Arabes (1974) – und deckt die Dialektik psycho-sozialer Abhängigkeit auf: La dépendance (1979; dt. Von Süchten und Sehnsüchten; Le buveur et l’Amoureux (1998; dt. Trinker und Liebende).
 Die Salzsäule , Verlag Wagenbach April 2002
Die Salzsäule , Verlag Wagenbach April 2002
Albert Memmi erzählt seine eigene Geschichte: er blickt zurück, um seine Herkunft zu erkennen.
Sohn einer berberischen Mutter und eines jüdischen Vaters, erzogen in einem französischen Gymnasium, steht er zwischen armen Handwerkern und reichem Bürgertum, zwischen einer alten und einer modernen Welt.
Wird er die Gerüche, die Stimmungen, die Farben, wird er Tunis und die Personen seiner Kindheit hinter sich lassen, den Vater mit seinen Hustenanfällen, die tanzende Mutter, das schöne Mädchen Ginou – und ein neues Leben und eine neue Heimat finden?
Im Kinzelbach Verlag erschienen Das kleine Glück(1997) und Von Süchten und Sehnsüchten (1999).
Sein autobiographisch geprägtes Romanquintett umkreist Fragen identitärer Zersplitterung, Wurzelsuche und Wege der Selbstfindung im kolonialen (La statue de sel, 1953, dt. Die Salzsäule; Agar, 1955, dt. Die Fremde) und postkolonialen (Le scorpion, 1969; Le désert, 1977; Le Pharaon, 1988; dt. Der Pharao) tunesischen Kontext.
Wie tief er sich seiner tunesischen Heimat, die er 1956 verlassen hat, bis heute verbunden weiß, davon zeugt der folgende spontane Text, den er zu seinem 90 Geburtstags geschrieben hat.
Eine Kindheit im Abseits, als Angehöriger einer Minderheit
Ich glaube nicht, dass es wirklich etwas Besonderes ist, als jüdisches Kind in einem muslimischen Mittelmeerland aufzuwachsen. Als ich nach Europa kam, entdeckte ich zahlreiche Ähnlichkeiten zu den Lebensumständen jüdischer Kinder in den deutschsprachigen Ländern oder in Russland.
Natürlich mit lokalen Varianten. Wir sprachen ein jüdisch-arabisches Gemisch voll französischer und italienischer Einsprengsel, dazu das Hebräische, ein lebendiger und geheimer Schatz. Sie sprachen Jiddisch. Und die Beziehung zur dominie renden Sprache, bei uns das Französische (es hätte ebenso gut das Italienische sein können, wenn Italien die Stelle Frankreichs in Nordafrika eingenommen hätte), bei ihnen das Deutsche oder Russische.
Aber in beiden Fällen gab es je zwei Sprachen: die herrschende Sprache, die der Mehrheit, undunseren Dialekt. Ziemlich schnell, schon in der Primarschule, musste ich lernen, das Französische zu beherrschen. Vielleicht bin ich ja aus diesem Grund Schriftsteller geworden: eine Form, Europas Zivilisation und seine Vormachtstellung zu beherrschen, ihnen zu huldigen.
Unsere Beziehung zu den Muslimen war völlig anderer Natur. Wir teilten die meisten unserer kulturellen Merkmale mit ihnen: die gleiche Küche, dieselbe Musik, dieselbe affektive Wärme und Verbundenheit, usw.
Doch zugleich bestimmten Misstrauen und sogar Angst unser Verhältnis zu ihnen. Und gelegentlich erinnerte uns eine Explosion daran, welches unsere Position in der Gesellschaft war: es war immer auch ein Gefühl ständiger Bedrohung da und, daraus resultierend, der Rückzug auf sich selbst.
Damit habe ich letztlich eine Definition dessen angedacht, was es heißt, Angehöriger einer Minderheit zu sein. Müsste ich unsere Existenz zu jener Zeit in knappen Worten umreißen, ich würde sagen, wir waren wesensmäßig, von unserem Sein und Lebensgefühl her, eine Minderheit, eine Gruppe im Abseits.
Ich glaube sowieso, dass dies eins der charakteristischen Merkmale jüdischer Existenz überhaupt ist, wo auch immer auf der Welt.
Von daher rührt vermutlich auch mehr als eine Strategie, sich in dieser Existenz einzurichten oder sie zu überwinden. Manche Berufe zum Beispiel: die Medizin, die es einem erlaubt, sein Wissen überall hin mitzunehmen, überall anzuwenden. Oder (man wirft es uns oft genug vor) das Streben nach ökonomischem Erfolg. Ich bin diesem Hin und Her meiner Kindheit zwischen zwei Kulturen, die beide auf ihre Weise dominant sind, niemals entkommen. Mein Heimatland, meine Kindheitsimpressionen finden sich bis auf den heutigen Tag in der Hälfte meiner Bücher wieder, und ich empfinde tiefe Solidarität fürdie Geschicke der einst Kolonisierten: ich habe viele Freundschaften, viele emotionale Bindungen nach dort; auf der anderen Seite bleibt das Ringen um die Beherrschung der französischen Sprache, der europäischen Zivilisation eine ständige Herausforderung.
Paris, im Dezember 2010 (ÜS: Regina Keil-Sagawe, Heidelberg)
Hier ist der originale Text auf Französisch.
L’enfance d’un minoritaire
Je ne crois pas qu’il y ait une spécificité de l’enfance d’un enfant juif en pays musulmans de la Méditerranée.
Lorsque j’ai gagné l’Europe, j’ai découvert bien des similitudes entre cette condition et celle des enfants juifs dans les pays germaniques et russes. Bien entendu, avec les variantes locales. Nous parlions un judéo-arabe truffé de francais et d’italien, plus l’hébreu, qui demeurait un trés or vivant et secret. Eux parlaient yiddish. Mais notre relation à la langue dominante, le français (cela aurait pu être l’italien, si l’Italie avait supplanté la France en Afrique du Nord), eux, la relation au russe ou à l‘allemand.
Mais, dans les deux cas, nous avions deux langues, la langue dominante, celle de la majorité, et un dialecte.
Assez vite, depuis l’école primaire, il me fallait conquérir la maîtrise du français. C’est peut-être pour ça que je suis devenu un écrivain : c’était une manière de maîtriser, de courtiser la civilisation et le pouvoir européens.
Nos relations avec les musulmans étaient d’une toute autre nature. Nous en partagions la plupart des traits culturels: la cuisine, la musique, le cousinage affectif,etc.
Mais, en même temps, nous avions vis-à-vis d’eux méfiance et même peur. Du reste, de temps en temps, une explosion nous rappelait notre condition: c’est-à-dire à la fois un sentiment de menace permanente et le resserrement sur soi qui en résultait.
Je viens en somme du suggérer une définition du minoritaire. En effet, si j’avais à caractériser notre condition de l’époque, je dirais que nous étions essentiellement des minoritaires.
Je pense, du reste, que c’est l’un des traits de toute condition juive, n’importe où dans le monde. D’où probablement un certain nombre de conduites pour l’aménager ou la surmonter. Par exemple, certains métiers. La médecine qui permet de transporter et d’utiliser son savoir n’importe où. Ou (on nous le reproche assez) des tentatives de réussite économique.
Je ne suis jamais sorti de ce va-et-vient de mon enfance entre deux cultures, dominantes toutes les deux, chacune à sa manière. Mon pays natal, mes impressions d’enfance se trouvent dans la moitié de mes livres, aujourd’hui encore, et je demeure profondément solidaire du destin des ex-colonisés: j’y ai plusieurs de mes amitiés, de mes affections; et, d’autre part, la bataille pour la maîtrise de la langue française et de la civilisation européenne exige de moi un effort constant. Paris, décembre 2010