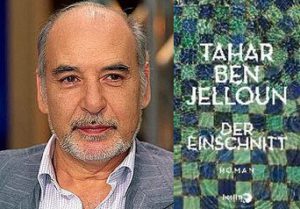Mohammed Arkoun – Algerischer Philosoph und Islamwissenschaftler
Muhammad Arkoun, ein moderner Philosoph, wurde in Algerien geboren, lebte in Frankreich und fand seine letzte Ruhestätte in Marokko. Er verfolgte eine Vision, die über die Moderne hinausging, doch war er frustriert darüber, dass Europäer ihn oft als traditionellen Muslim wahrnahmen. Er wagte es, den islamischen Geist mit einer französischen Perspektive und einem westlich-orientalistischen Ansatz zu hinterfragen.
Geburt und Kindheit
Muhammad Arkoun wurde am 1. Februar 1928 im Dorf Taourirt Mimoun im Tizi Ouzou in der Großkabylei in Algerien geboren. Er wuchs in einer bescheidenen Berberfamilie auf und schilderte in seiner persönlichen Korrespondenz, wie seine Familie auf der Suche nach Schutz ihre ursprüngliche Heimat in Konstantin verließ und nach Taourirt Mimoun zog.
Studium und Ausbildung
Er begann seine Grundschulausbildung in Taourirt Mimoun und schloss sich im Alter von neun Jahren seinem Vater im Gouvernement Ain Temouchent im Westen Algeriens an, wo er Arabisch und Französisch lernte.
Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage seiner Familie war es ihm nicht möglich, in die Hauptstadt Algier zu reisen, um seine weiterführende Ausbildung fortzusetzen. Stattdessen besuchte er eine Schule, die von weißen Missionaren geleitet wurde, die in Oran zwischen 1941 und 1945 tätig waren. Während dieser Zeit tauchte er in die lateinische Kultur und Literatur ein, lernte christliche Werte und machte sich mit den Werken der afrikanischen Kirchenväter Tertullian, Soprian und Augustinus vertraut. Während dieser Zeit tauchte er in die lateinische Kultur und Literatur ein, lernte christliche Werte und machte sich mit den Werken der afrikanischen Kirchenväter Tertullian, Soprian und Augustinus vertraut.
Zwischen 1950 und 1954 wechselte er an die Fakultät für Literatur der Universität Algier und studierte nicht nur Literatur, sondern beschäftigte sich auch mit dem Studium der Philosophie, des Rechts und der Geographie. Mitte der fünfziger Jahre wechselte er an die Sorbonne-Universität Empfehlung des Orientalisten Louis Massignon, wo er im Juni 1969 in Philosophie promovierte.
Berufliche Laufbahn
Muhammad Arkoun hatte eine beeindruckende Karriere und unterrichtete als Professor an verschiedenen internationalen Universitäten, darunter die Sorbonne-Universität, wo er sich auf islamische Geschichte spezialisierte (1961–1969), die Universität Lyon (1970–1972), die University of California (1969) und die New York University (2001–2003). Er engagierte sich auch in verschiedenen Gremien und Ausschüssen, darunter das Institute of Islamic Studies in London (1993–2010) und das Schiedskomitee für den Arabisch-Französischen Preis (2002).
Arkoun war der wissenschaftliche Leiter des Arabica-Magazins (1979–2008), wissenschaftlicher Berater der Library of Congress in Washington (2000–2003) und Vorsitzender der Jury des Sharjah Cultural Award im Jahr 2010.
Gedanken und Einflüsse:
Arkoun widmete sich der kritischen Analyse des islamischen Geistes, indem er religiöse Texte und die Prinzipien der islamischen Rechtsgelehrten der ersten drei Jahrhunderte studierte. Er argumentierte, dass diese Prinzipien im Laufe der Zeit zu heiligen Gesetzen geworden waren, die unveränderbar blieben, selbst angesichts veränderter historischer und sozialer Umstände. Er versuchte, den religiösen Text durch literarische Analyse und umgebende Beweise zu verstehen.
Einige Fachleute für islamisches Denken kritisierten Arkouns Ansatz, da sie meinten, dass er westliche Methoden verwendet habe, um dem religiösen Text seinen sakralen Charakter zu nehmen. Kritiker argumentierten auch, dass sein intellektuelles Projekt eine Reflexion über die Erfahrungen des französischen Denkens und dessen Haltung zum europäischen christlich-lateinischen Erbe sei.
Trotz seiner Überzeugungen in Bezug auf die Postmoderne und sein Eintauchen in westliches Denken bedauerte Arkoun zutiefst, dass Europäer ihn oft als einen traditionellen Muslim wahrnahmen.
Werke
Arkoun verfasste zahlreiche Bücher, darunter „Arab Thought,“ „Islam Between Yesterday and Tomorrow,“ „Historical Arab-Islamic Thought,“ „Islamic Thought as a Scientific Reading,“ „Islam, Ethics, and Politics,“ „Thinking,“ „Islam Critique and Ijtihad,“ and „The Impossibility of Rooting.“ Er schrieb auch viele Artikel und Studien zu verschiedenen Themen.
Ehrungen und Auszeichnungen
Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter den Titel „Academic Officer of the Palms“ im Jahr 1979, den „Officer of the Brigade of Honor“ im Jahr 1984 und die Ehrendoktorwürde der University of Exeter im Jahr 2008. Außerdem erhielt er am 10. Mai 2002 den Levy-Della-Preis für Nahoststudien in Kalifornien, im Dezember 2003 den Ibn-Rushd-Preis für freies Denken in Berlin und im Februar 2010 den Preis der Hauptstadt der arabischen Kultur in Doha.
Tod
Muhammad Arkoun starb am 15. September 2010 im Alter von achtzig Jahren und wurde in Umsetzung seines Willens auf dem Märtyrerfriedhof in der marokkanischen Hauptstadt Rabat beigesetzt.